Was ist Schizophrenie ?
Schizophrenie ist eine tief greifende psychiatrische Erkrankung (Nervenkrankheit, Psychose), die Veränderungen der Gedanken, der Wahrnehmung und des Verhaltens auslöst. Schizophreniekranke sind zeitweise nicht in der Lage, zwischen der Wirklichkeit und den eigenen Vorstellungen zu unterscheiden. Schizophrene Patienten glauben jedoch nicht, eine andere oder mehrere andere Personen zu sein (multiple Persönlichkeitsstörung), wie das etwa in der Geschichte von Dr. Jekyll und Mr. Hyde der Fall ist. Die Erkrankung gehört zu den endogenen Psychosen, das heißt, die Krankheit entsteht anlagebedingt.
Laut Statistiken erkranken etwa 800.000 Bundesbürger mindestens einmal im Leben an einer Schizophrenie, erstmals meist zwischen dem 18. und 35. Lebensjahr. Es erkranken gleich viel Männer und Frauen, Frauen meist zwischen dem 25.und dem 35. Lebensjahr, Männer häufig im Alter zwischen 15 und 30 Jahren. Eine richtig durchgeführte Behandlung ermöglicht heutzutage einem Großteil der Patienten (80 Prozent) dauerhaft ein Leben außerhalb des Krankenhauses. Die meisten dieser Gruppe können zumindest zeitweise auch einen Beruf ausüben.
Wie entsteht Schizophrenie?
Die genauen Ursachen der Erkrankung sind unbekannt. Vermutlich spielen chemische Botenstoffe, die Nervensignale weiterleiten (Neurotransmitter), eine entscheidende Rolle. Früher deutete man die Schizophrenie als Folge einer Überproduktion an dem Neurotransmitter Dopamin. Neuere Untersuchungen weisen jedoch darauf hin, dass wohl ein Teil der DopaminSignalwege überaktiv ist. Sicher spielt Vererbuny eine Rolle. Das Risiko, irgendwann im Leben eine Schizophrenie zu entwickeln, steigt von einem auf drei Prozent, wenn einer der Großeltern betroffen ist, beziehungsweise auf zehn Prozent, wenn einer der beiden Elternteile erkrankt ist.
Eineiige Zwillingsgeschwister sind jedoch nur zu 40 bis 60 Prozent beide betroffen, sodass erbliche (genetische) Faktoren nicht die einzig mögliche Ursache der Schizophrenie sein können. Vermutlich erben manche Menschen eine besondere Anfälligkeit gegenüber der Krankheit, die bei hinzutretenden Belastungen dann ausgelöst wird. Geburtskomplikationen oder schwere körperliche Krankheiten können solche Auslöser sein, in 50 Prozent der Fälle aber gehen einer Erkrankung oder Wiedererkrankung psychische Belastungen (unglückliche Kindheit, Stress in der Arbeit, im zwischenmenschlichen Bereich) voraus.
Welche Beschwerden treten bei Schizophrenie auf?
Schizophrenie kann praktisch alle psychischen Funktionen verändern. Es zeigt sich eine Vielzahl an Beschwerden, die beim einzelnen Kranken nicht alle und nicht gleich stark ausgeprägt in Erscheinung treten müssen. Sie verbinden sich manchmal zu Syndromen, das sind typische Kombination von Beschwerden, die auch wechseln können. Man unterscheidet zwischen Grundbeschwerden und zusätzlichen (akzessorischen) Beschwerden. Manchmal wird in der Literatur auch von produktiven oder positiven Beschwerden und Minus- oder negative Beschwerden gesprochen. Beide Arten von Beschwerden sind einander sehr ähnlich und können oft nicht unterschieden werden.
Grundbeschwerden sind die direkt von der Krankheit verursachten Störungen:
Störungen des Denkens und damit auch Sprechens: Das Denken ist zusammenhanglos, nicht logisch, zerfahren, Gedanken und Worte brechen mitten im Satz ab. Begriffe verlieren ihre exakte Bedeutung oder verschiedene Begriffe werden neu miteinander verbunden („trauram" aus traurig und grausam).
Störungen des Gefühlslebens (Affekt) und des Antriebs: Stimmungslage und gegenwärtige Situation passen nicht zusammen (inadäquate Affektivität). Gegensätzliche Gefühlsregungen werden nebeneinander empfunden, der Patient weint und lacht gleichzeitig.
Verlust der Wirklichkeit (Autismus):
Der Schizophrene versinkt in seine eigene Welt und ist von der Wirklichkeit anderer Menschen abgeschnitten.
Ich-Störung:
Schizophrene Patienten erleben die eigene Persönlichkeit ebenfalls gespalten, zusammenhanglos, zerschlagen. Sie haben manchmal Schwierigkeiten sicher zu sein, dass sie wirklich leben, dass sie sie selber sind.
Die zusätzliche Beschwerden sind Versuche des schizophrenen Patienten, das krankhaft Erlebte in einen Sinnzusammenhang zu bringen oder damit leben zu können. Die Bewältigungsarten sind aber in sich ebenfalls krankhaft.
Störungen des Denkens:
Die eigenen Gedanken empfindet der Patient als fremd, manchmal glaubt er, sie würden ihm entzogen.
Störungen des Gefühlslebens (Affekt) und des Antriebs:
Das alles beherrschende Gefühl ist Angst. Manchmal sind schizophrene Menschen albern, enthemmt und ausgelassen (gehobene, hebephrene Stimmungslage) häufiger jedoch ratlos, hilflos und anlehnungsbedürftig (depressive Verstimmung). Die Gefahr eines Selbstmords in solchen Situationen ist unberechenbar, das Risiko liegt bei zehn Prozent.
Wahnvorstellungen:
Schizophrene können fest davon überzeugt sein, dass sie verfolgt werden, dass sich die Umwelt gegen sie verschworen hat, dass sie vergiftet werden sollen. Die Patienten haben keine Möglichkeit zu begreifen (etwa mit Hilfe logischer Argumente), dass sie sich täuschen.
Halluzinationen:
Die Kranken hören Geräusche und Stimmen, riechen Giftstoffe. Meist werden sie so im Rahmen des Verfolgungswahns bedroht. Auch hier ist es unmöglich, die Kranken mit Argumenten aus diesen Vorstellungswelten herauszuführen.
Bewegungsstörungen (Katatone Beschwerden):
Manchmal verlangsamt die Krankheit die Bewegungen der Patienten stark. Er bewegt sich kaum und spricht nicht mehr (Stupor). Im schlimmsten Fall kann sich ein Kranker gar nicht mehr bewegen, er verharrt in unbequemen Stellungen (Katalepsie). Kommt Fieber hinzu (perniziöse Katalepsie), wird der Zustand lebensbedrohlich. Andererseits wiederholen Schizophrene in psychischen Erregungszuständen häufig immer wieder Bewegungen. Sie laufen hin und her, machen Kniebeugen und andere Turnübungen, klatschen in die Hände oder klopfen ständig mit den Fingern.
Die Krankheit kann einen schleichenden oder akuten Verlauf nehmen. Von einem schleichenden Verlauf spricht der Mediziner, wenn sich der Patient immer mehr zurückzieht, von Familien und Freunden isoliert, sich um nichts mehr kümmern möchte und jegliches Interesse an der Ausbildung, der Arbeit oder den Hobbys verliert. Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten, Unentschlossenheit, abrupte Gefühlsänderungen, Drogenmissbrauch und Interesse an okkulten Themen können auch Teil des Krankheitsbilds sein.
Bei manchen Patienten beobachtet man stetige Beschwerden, über die Hälfte der Patienten erleiden wellenförmig akute Phasen und sind in der Zeit dazwischen beschwerdefrei, wobei die Verarbeitung der als bedrohlich erlebten Beschwerden zu beträchtlichen Persönlichkeitsstörungen führen kann.
Wie erstellt der Arzt die Diagnose ?
Die Diagnose wird durch ein ausführliches Gespräch mit dem Patienten gestellt. Dabei achtet der Arzt besonders auf die typischen Beschwerden zum Zeitpunkt der Untersuchung und in der Vorgeschichte. Nachdem der Kranke seine Krankheit in Anteilen nicht wahrnehmen kann, ist es unter Umständen wichtig, Familienangehörige, Freunde oder Lehrer zu befragen. Tests (Rorschach-Test, Fragebögen, Konzentrationsübungen) werden zur Diagnosestellung nur wenig eingesetzt.
Wie wird die Schizophrenie behandelt ?
Neuroleptika :
Neuroleptika (Entdeckung im Jahr 1952) blockieren die Wirkung des Nervenbotenstoffs Dopamin im Gehirn (Dopamin-Antagonisten). Damit sind sie die Grundlage der Behandlung von Psychosen wie der Schizophrenie.
Die "klassischen" Neuroleptika sind besonders bei den Grundbeschwerden wirksam. Allerdings haben sie auch stärkere Nebenwirkungen wie Bewegungsstörungen (Muskelsteifigkeit, Zittern) unwillkürliche Muskelzuckungen (Spätdyskinesien), Dämpfung des Empfindens, Müdigkeit, Antriebslosigkeit sowie Gewichtszunahme. Die neueren antipsychotischen Medikamente haben eine günstige Wirkung auch auf die zusätzlichen Beschwerden. Ein weiterer Vorteil dieser neuen oder „atypischen" Neuroleptika ist, dass sie weniger gravierende Nebenwirkungen verursachen als die klassischen.
Die verschiedenen Neuroleptika werden unterschiedlich dosiert gegeben, je nachdem, unter welchen Symptomen der Patient gerade leidet, ob ein akuter Schub bekämpft werden muss oder eine Wiedererkrankung verhindert werden soll.
Trotz der zum langen Liste an Nebenwirkungen sind Neuroleptika in der Regel gut verträglich. Die meisten Nebenwirkungen mit Ausnahme der unwillkürliche Muskelzuckungen verschwinden nach Absetzen des Mittels wieder.
Antidepressiva:
Antidepressiva beeinflussen Stimmung, Antrieb und Leistungsfähigkeit der schizophrenen Patienten positiv. Wenn eine depressive Grundstimmung vorliegt, werden sie zusätzlich zu den antipsychotisch wirksamen Neuroleptika gegeben.
Beruhigungsmittel:
Sie lösen Angstzustände und wirken entspannend. Sie können jedoch abhängig machen.
Psychotherapie:
Die verschiedenen Behandlungsformen der Psychotherapie haben auf die Grunderkrankung nur einen geringen Effekt. Jedoch können sie entscheidend helfen, die beängstigenden Erlebnisse während der Krankheitszeiten zu verarbeiten und damit die Folgen der Erkrankung für die Persönlichkeit positiv zu beeinflussen. Psychotherapien steigern das Selbstwertgefühl, stärken die eigene Initiative, trainieren die Konzentrationsfähigkeit, zeigen Bewältigungsansätze auf, ermöglichen die Aufnahme einer Berufstätigkeit und verhindern die soziale Isolierung. In Arbeit mit den Angehörigen sucht man nach Möglichkeiten, wie der Schizophrene in der familiären Umgebung am besten betreut werden kann. Psychotherapie ist oft Voraussetzung für den Beginn einer medikamentösen Behandlung und deren zuverlässige Weiterführung.
Was kann man selbst tun ?
Am Wichtigsten ist es, dass sich Patienten und Angehörige ausführlich über die Krankheit, ihre Ursachen und die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten informieren. Nur dann sind sie in der Lage, für eine optimale Behandlung zu sorgen und alle Maßnahmen zu ergreifen, um ein Wiederauftreten der Beschwerden zu verhindern. Um Rückfälle möglichst sicher verhindern zu können, ist es wichtig, die Medikamente so lange einzunehmen, wie dies vom behandelnden Arzt empfohlen wird. DieBehandlung dauert oft viele Jahre lang. Gute Zusammenarbeit mit dem Behandlungsteam, eine geregelte und möglichst stressarme Lebensführung sowie das Vermeiden von Drogen sind weitere wichtige Voraussetzungen für die erfolgreiche Rückfallverhütung. Da es zum Wesen der Krankheit gehört, dass der von ihr Betroffene nicht immer erkennt, dass er krank und behandlungsbedürftig ist, sollten ihm seine Angehörigen dabei helfen, drohende Rückfälle zu erkennen und rechtzeitig eine Behandlung einzuleiten.
Wie ist die Prognose ?
Schizophrenie ist eine langwierige, beängstigende und auch für die Angehörigen psychisch belastende Krankheit. Dennoch wird sie im Allgemeinen als schwerwiegender und dramatischer beurteilt, als die nüchternen Zahlen dies belegen.
Bei jedem Fünften heilt eine Ersterkrankung ohne Wiederkehr aus. Selbst nach jahrelanger Krankheitsdauer bessert sich der Zustand mancher Patienten plötzlich. Bei anderen kommt es zur Wiedererkrankung in unterschiedlichen Zeitabständen und mit unterschiedlicher Häufigkeit. Zum einen bestimmt die Eigengesetzlichkeit der Krankheit selbst den Verlauf. Sodann hängt die weitere Entwicklung von den persönlichen und sozialen Bewältigungsmöglichkeiten des Patienten ab. Alles entscheidend beeinflusst aber eine ausreichende und zuverlässig eingehaltene Neuroleptika-Therapie die Prognose günstig. Wenn die Medikamente regelmäßig eingenommen werden, sinkt die Zahl der Wiedererkrankungen auf 30 Prozent.
Jeder dritte chronische Verlauf ist leicht. Ein Drittel der Patienten erreicht eine gewisse Besserung mit zwischenzeitlichen Rückfällen, und ein weiteres Drittel hat eine ungünstige Prognose mit bleibenden und zunehmenden Persönlichkeitsveränderungen, die bei jedem Rückfall verstärkt werden. Günstig ist, wenn die Krankheit in späten Jahren plötzlich beginnt und eher die zusätzlichen Beschwerden aufweist.
Ein ständiger Aufenthalt im Krankenhaus ist nur bei jedem Vierten nötig, 60 Prozent der Betroffenen gliedern sich wieder in das soziale Umfeld ein und können arbeiten. Die Krankheit reduziert die Lebenserwartung der Betroffenen um durchschnittlich zehn Jahre.
|
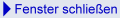
|
|